Jean-Patrick Manchettes zentraler Roman thematisiert seine Abkehr von dem Glauben an eine gesellschaftliche Veränderung und die ausweglose Lage, in der wir uns heute mehr denn je befinden. Grandios!
Der Story-Ansatz von LE PETIT BLEU DE LA CôTE OUEST (Originaltitel) könnte einem Hitchcock-Film entlehnt sein: Ein leitender Angestellter hilft einem verunglückten Autofahrer und wird daraufhin von zwei Killern quer durch Frankreich gehetzt – und er weiß nicht, warum.

Zu Beginn umkreisen wir mit Georges Gerfaut das nächtliche Paris auf der Peripherique und folgen ihm in ein absurdes Abenteuer, in dessen Verlauf Gerfaut zwei Menschen und einen Hund tötet. Aber das hat nichts mit der nächtlichen Autofahrt zu tun. „Was zur Zeit geschieht, ist schon öfter vorgekommen …“
Als Manchette anfing, die Geschichte zu entwickeln, stellte er sich die Frage, was wohl ein ganz und gar debiles Thema wäre? Für seinen Ausgangspunkt suchte er nach einer abstrakten Idee. Die Antwort: Le malaise des cadres. Die Leiden der neuen Mittelschicht.
Tagebucheintrag, Donnerstag, 8. August, 1974: „… ich kenne Bangkok nicht, ich kenne Saint-Georges-de-Didonne, also schreibe ich nicht über Bangkok, sondern über Saint-Georges-de-Didonne. Außerdem interessiert mich die soziale Kritik. Ich schreibe genauso wenig über das Proletariat, wie ich über Bangkok schreibe. Ich schreibe über das Milieu, das mir nahe steht.“
Das Milieu des Georges Gerfaut kannte Manchette sehr genau: Es ist die bürgerliche Welt der aufstrebenden Mittelschicht, der er selbst entstammte. Gerfaut ist ein Cadre, einer jener jungen erfolgreichen Manager, die im Frankreich des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem 2. Weltkrieg aufwuchsen und Karriere machten. Die glorreichen 30 Jahre veränderten völlig Land und Leute: Frankreich mutierte zu einer Konsumgesellschaft. Der neue materielle Wohlstand fiel in eine politisch äußerst bewegte Zeit. Die Überseebesitztümer brachen mit ihrem Kolonialherren, erst Indochina (Vietnam), dann Algerien, die vierte Republik war am Ende. Es folgte die Rückkehr von de Gaulle an die Macht, die Gründung der fünften Französischen Republik, die militärisch-straffe Ausrichtung der staatlich-ökonomischen Institutionen und schließlich der Mai 1968. Dieser zentrale gesellschaftliche Moment, inzwischen zum Mythos verklärt, verpuffte jedoch politisch zumindest sang- und klanglos. Die Fortschritte bei den individuellen Freiheitsrechten ungeachtet, sagte Manchette, er hätte ab 1976 nicht mehr an eine radikale gesellschaftliche Veränderung, an die Revolution in Frankreich geglaubt. Für ihn hatte die Konterrevolution endgültig gesiegt. (Heute wissen wir, sie fing damals gerade erst an, richtig Fahrt aufzunehmen.)
Soll man Georges Gerfaut als Protagonisten oder als Subjekt bezeichnen? Richtigerweise müsste die Antwort lauten: als Objekt. Denn Gerfaut wird ausschließlich durch die materiellen Dinge, die ihn umgeben, beschrieben. Da gibt es den stahlgrauen Mercedes mit dem mahagonifarbenen Innenraum, einschließlich der Ledersitze im selben Farbton, die Gitanes-Zigaretten und das Dunhill-Feuerzeug, den schiefergrauen Anzug mit gestreiftem Jerseyhemd und uniweißem Kragen, die pflaumenblaue Krawatte, sowie die passenden pflaumenblauen Schuhe mit Steppnähten.

Gerfauts persönlicher Soundtrack ist der Westcoast-Jazz, Musik aus seiner Jugend, von Chico Hamilton, Hampton Hawes, Gerry Mulligan, die er auf einer Sharp-Stereoanlage abspielt. Er trinkt Whiskey der Marke Cutty Sark und ist mit einer „schönen, kräftigen Stute“ namens Bea verheiratet, die mit PR im Filmgeschäft ihr Geld verdient. Das junge Paar hat zwei Kinder. Die heißen nur „die Mädchen“, nerven ständig und sind allein mit Fernsehschauen ruhigzustellen. (Die Story spielt in den 1970er Jahren. Heute würden die Blagen mit dem Smartphone ruhiggestellt.)
Für Manchette besteht in unserer kapitalistischen Welt zwischen Konsumgütern und Menschen, zwischen Charakter- und Produkteigenschaften kein Unterschied mehr. Alles und jeder ist Ware.
Georges Gerfaut verdankt sein Leben „seinem Platz innerhalb der Produktionsverhältnisse“. Dieser Satz aus dem 1. Kapitel bezieht sich ebenso auf die materielle Welt und den Wohlstand seines Daseins, wie auf den Dreck, die Luftverschmutzung, den Konsummüll, den Fraß, den er in sich hineinstopft, den Urlaub am überfüllten Strand von Saint-Georges-de-Didonne, mit einem Meer, das mehr Brühe als Ozean ist – und natürlich bezieht er sich auch auf das Schicksal, welches Gerfaut in Form von zwei Killern ereilt. Mit seiner Flucht vor den Auftragsmördern, Freiberuflern, die in der Profession ihrer Wahl eine legitime Karriere sehen und schon „Zielpersonen jeder gesellschaftlichen Schicht und verschiedensten Berufen eliminiert hatten“, verliert Gerfaut seine ihn in einen schützenden Kokon einhüllenden Konsumgüter.
Tagebucheintrag, Dienstag, 11. April 1976: „ … als Titel kommt zudem noch „Le petit bleu de la cote ouest“ in Betracht, der sich auf die Situation bleu der Hauptfigur (bleu kann sowohl für „blaue Flecken“ stehen, als auch „vor Angst erstarrt“ bedeuten – A.d.V.) und natürlich den West Coast Blues bezieht.“

Von Anfang an vermittelt die Geschichte eine besondere Nervosität, Alkohol gemischt mit Barbituraten wirkt nicht einschläfernd, sondern „löst eine angespannte Euphorie aus, die jeder Zeit in Wut oder tschechowsche Melancholie umschlagen könnte“. Gerfaut kann die Ursachen für sein Gefühlswirrwarr nicht ausmachen. Er empfindet eine ständige Irritation, erhält von überall doppeldeutige Signale. Seine Sekretärin reckt ihm – aus seiner männlich chauvinistischen Sicht – den Hintern hin, doch er weiß, sie würde losschreien, ihm das Gesicht zerkratzen, wenn er sie anfasst. Er fühlt sich sexualisiert und frustriert zugleich. Bei jeder Gelegenheit wird gesoffen und gequalmt. Der kritisch-selbstgefällige Blick in den Spiegel registriert neben noch adäquater Proportionen und Muskelspannung ebenso die Gefahrensignale eines beginnenden Speckbauches. Man könnte meinen, Gerfaut empfinde am eigenen Leib das „Unbehagen der Zivilisation“.
Der erste Anschlag auf sein Leben löst einen Veränderungsprozess aus, den Gerfaut nicht kapiert. Seine ziellose Autofahrt Richtung Süden mutet wie der unbewusste Versuch an, die Gefahr von der Familie wegzulocken und eine Konfrontation mit den Angreifern herbeizuführen. Wir wissen es nicht genau. In einer Nachricht an seine Frau verschweigt er den Mordanschlag, gibt keine wirklichen Gründe für sein plötzliches Verschwinden an. Allerdings hat er sich von einem Genossen aus alten linken Jugendtagen eine Pistole besorgt und scheint auf einen weiteren Angriff vorbereitet. Der zweite Anschlag schleudert Gerfaut förmlich aus seiner bürgerlichen Existenz. Knapp den Killern entkommen, rettet er sich in einen Güterzug, wo ihn ein Landstreicher während der Fahrt ausraubt und hinauswirft. Verletzt und fiebrig, ohne Geld und ohne Papiere kriecht Gerfaut durchs Gebirge. In seiner Vorstellung vergleicht er seine Lage mit der eines Mannes unter Wölfen in einem Western und mit einem entstellten Gangster, der sich an seinen ehemaligen Komplizen rächt. Gerfauts Bezüge zur realen Welt sind die Popkultur-Phantasien von Drehbuchautoren und Filmregisseuren: pseudo-heroische und absurde Gedankenspiele.
Nur schert sich die Natur einen Dreck um Gerfauts illusorischen Glauben an die eigene Unzerstörbarkeit. Seine Lage ist mehr als beschissen. Anflüge von Heldenmut und Trotz, Furcht und Selbstmitleid wechseln einander ab. Am Ende siegt der nackte Überlebenswille.

Mühsam kämpft er sich hinab ins Tal. In der Nähe eines Holzfällerlagers wird er entdeckt. Kaum wieder unter Menschen, verlässt ihn seine Energie. Er gibt einen falschen Namen an, behauptet, seine Frau verlassen zu haben, und bleibt bei dem alten Sanitäter, der ihn gesund pflegt. Als dieser stirbt, wohnt Gerfaut weiterhin in dessen Hütte, weil die Nichte des Alten mit ihm, der interessanter wirkt als ihr langweiliger Freund aus der Stadt, ein Verhältnis anfängt. In seinem neuen Leben ist Gerfaut ein passiver, beinahe lethargischer Mensch mit wenigen materiellen Bedürfnissen, ein Transistorradio, etwas Tabak, etwas Wein … Er lässt sich treiben. Erst ein dritter Tötungsversuch, bei dem die unschuldige Gespielin – er liebt sie nicht – stirbt, katapultiert ihn aus seiner Lethargie. Gerfaut tötet den Angreifer, kehrt in die Zivilisation nach Paris zurück und spürt den Auftraggeber der beiden Killer auf.
Durch den reichen Hintermann, der – wie klein und entlarvend – ein jämmerliches, von Paranoia und Angst vor Entdeckung bestimmtes Dasein fristet, werden die internationalen Verflechtungen von Politik und Wirtschaft, von globaler Hegemonie und kapitalistischer Expansion sichtbar. Diese häufig im Verborgenen agierenden, das Weltgeschehen bestimmenden Kräfte bilden den dunklen Untergrund der Geschichte. Gerfaut ist ein wahlloses Opfer ihrer Willkür.
Den Regeln des Genres folgend, übt Gerfaut an dem Bösen tödliche Rache. Eine brutale und ekelige Sache. „Ein Roman noir braucht Actionszenen“, vermerkte Manchette dazu am Mittwoch, den 21. August 1974, in seinem Tagebuch.

Und was geschieht jetzt? Hat das Abenteuer Georges Gerfaut verändert? Ist er durch die Erlebnisse charakterlich gereift, gar ein neuer Mensch geworden?
Nun, die Realität ist so ernüchternd wie unsere eigene Existenz. Unvermittelt kehrt Gerfaut wieder zu seiner Familie, in sein vorheriges Leben zurück. Schmutzig und nach Erbrochenem riechend behauptet er, sich an nichts erinnern zu können. Seine Frau ist ihm all die Monate treu geblieben und schließt ihn überglücklich in die Arme, sein alter Arbeitgeber stellt ihn wieder ein, wenn auch auf einer schlechteren Position, von der er sich aber hocharbeiten wird. Nach und nach hören die neugierigen Fragen auf. Sogar die Polizei beendet irgendwann ergebnislos ihre Nachforschungen. Normalität als Happy-End? Gerfaut kommt mit seiner vorgetäuschten Amnesie durch, die er deshalb so überzeugend präsentieren kann, weil er in seiner Jugend eine Fibel über taktisch richtiges Verhalten bei Polizeiverhören gelesen hatte. Sein Widerstand gegen die Staatsgewalt erfolgt aus reinem Selbstschutz. Tief in Gerfauts Unterbewusstsein schlummern Restposten von Anarchie. Warum kam es ihm sonst die ganze Geschichte über niemals in den Sinn, zur Polizei zu gehen? Für brave, obrigkeitshörige Bürger absolut undenkbar.
In seinem Notizbuch notiert Gerfaut, er hätte „ein Künstler werden können, ein Mann der Aktion, ein Abenteurer, ein Haudegen, ein Eroberer oder irgendeine andere Person“. Er wurde aber nur ein langweiliger leitender Angestellter im Hamsterrad des Systems. Ein Verkäufer, der nachts völlig alleine nach übermäßigem Alkoholgenuss – jetzt 4-Roses-Bourbon statt Cutty Sark – und Barbituraten in rasender Fahrt auf der Peripherique Paris umkreist wie ein Satellit unseren blauen Planeten.
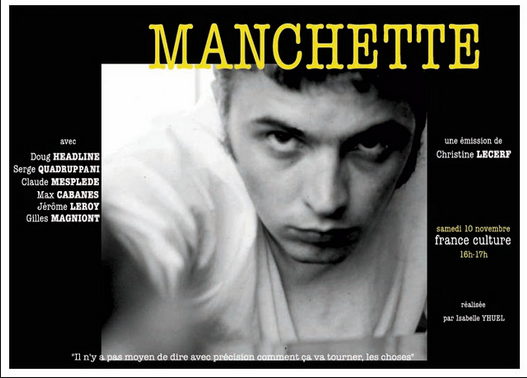
Zum Schluss weist Manchette darauf hin, dass „im Großen und Ganzen die Produktionsverhältnisse, in denen der Grund für Gerfauts seltsames Verhalten zu suchen ist, zerstört werden“. Das klingt wie die formelhafte Beschwörung eines überzeugten, aber desillusionierten Linken, denn schon im nächsten Satz relativiert er die Möglichkeit, Gerfaut könnte dann ein anderes, weniger unterwürfiges Verhalten an den Tag legen: „ … es ist aber unwahrscheinlich … denn Gerfaut ist ein Kind seiner Zeit und seines Raumes.“
„Die vorherrschende Ideologie tötet jede Hoffnung“, sagt Alain Badiou zu unserem politisch-ökonomischen Dilemma. „Der Roman noir ist das Ferment der Anarchie“, schreibt Jean-Patrick Manchette trotzig in seinem Tagebuch.
Recht hat er. Wir brauchen mehr davon.
LINKS:

