Lebend aus Jönköping zurück – das zahme Eichhörnchen hat’s leider nicht geschafft, ich muss meinem Nachbarn ein neues fangen – habe ich Iron Man und die Folgen (siehe Superhelden – Phänomenologie der Hohlheit) einfach nicht aus dem vernebelten Schädel bekommen.
Jeder weiß inzwischen, das amerikanische Kino verkauft uns Albträume von Individualität und Freiheit, meint in Wahrheit aber Konformität im Konsum. Schon mal aufgefallen, dass immer dann Happy-End ist, wenn man wieder in Frieden shoppen gehen kann? Damit dies auch in Zukunft so bleibt, wird die unverzichtbare Nation hemmungslos nach vorne verteidigt. Bald bestimmt auch gegen den Iran, getreu dem Motto von Obelix: „Ich dachte, er wollte mich schlagen, da habe ich zuerst zurückgeschlagen“. Wie die Superhelden-Lüge für einen prekären White-Trash-Boy zurecht geschustert wird, auf dass er patriotische Gefühle entwickelt und fröhlich in den Krieg zieht, veranschaulicht einer der übelsten Hollywood-Propagandaschinken schlechthin:
American Sniper (2014) von Clint Eastwood
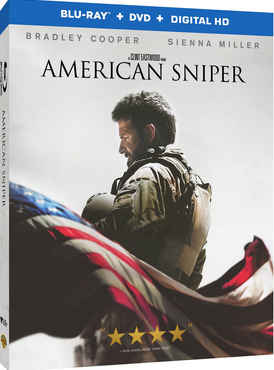
Vorab ein kleiner Schlenker in die Niederungen heimischer Schützenlöcher: Von dem im Folgenden durchleuchteten Spielfilm kann die Propagandaabteilung der Bundeswehr jede Menge lernen. Sie versucht ja derzeit mit Youtube-Videos über den Abenteuerspielplatz KSK und andere Truppenwitze, bis zu Plakataktionen wie „tolle Karrieren in Uniform“, Deutschlands Jugend fürs Kriegshandwerk zu begeistern. Die Werbung setzt dabei zu sehr auf persönliche Entfaltung und Fun, es fehlt an Pathos und Opferbereitschaft für den Auftrag – die Bereitschaft fürs Vaterland ins Gras zu beißen. Wie heldenhaft ist das denn?
Jetzt hinein in die Gehirnwäsche des militärisch-industriellen Komplexes.
Was ist davon zu halten, wenn ein beeindruckender Regiehandwerker, ein überlanges Werk absolut ökonomisch und filmisch perfekt erzählt, die Probleme jedoch Sujet und Protagonist, Krieg und Soldat sind, und somit der Film als solcher?

Vorlage für American Sniper ist die gleichnamige Autobiographie des US-Navy Seals und Snipers Chris Kyle. Ein Bestseller in Amerika.
Clint Eastwood fasziniert der Kampf Mann gegen Mann: US Sniper-Hero Kyle (gespielt von Bradley Cooper) gegen den syrischen Olympiasieger im Schießen und Sniper-Hero auf Seiten der Insurgents/Al Quaida. Ein Duell der Superhelden. Das erinnert an Achilles gegen Hector, und gehört zum klassischen Western. Im Kriegsfilm gab es so etwas zuletzt bei Enemy at the Gates (2001). Ein beliebtes Thema, die beiden erbitterten Kontrahenten, die sich aus der Ferne bekämpfen, haben im Grunde mehr miteinander gemein, als mit ihren eigenen Leuten. Ihre Feindschaft wurde von den Regierungen und den Generälen bestimmt. Soldatendilemma.
Weil Eastwood die Story vielschichtig und komplex schildert, erscheint American Sniper an der Oberfläche facettenreicher, als er es in Wirklichkeit ist. Denn wie bei jedem Eastwood-Streifen, ist die Erzählform knallhartes kommerzielles Kalkül, dem sich alles unterordnet. Wahrheit und damit auch versteckte Kritik am Militär und Soldatentum, die man durchaus sehen kann, wenn man will, erscheint nur dort, wo sie dramaturgisch nicht stört, mehr noch, wo sie der Illusion dient, andere würden sagen, dem Mythos.
Der erste große Irrtum des Films: Die offensichtlichen Widersprüche werden gezeigt und genau dadurch sofort entkräftet. Sie gehen im Strudel des großen persönlichen Dramas, der Geschichte des Scharfschützen Chris Kyle völlig unter.

Die Heldengeschichte endet natürlich nicht mit dem Showdown der Supersniper, sondern bleibt dem wirklichen Ende des Protagonisten treu. Ein Abgang mit Originalaufnahmen oder zumindest sehr dokumentarisch dem Original nachempfunden Aufnahmen von Chris Kyles letzter Reise, geben dem Zuschauer noch einmal – wenn auch restrained wie alles in diesem Film – einen ordentlichen Schuss aus der Pathospulle. Echte Kerle dürfen hier durchaus eine Träne verdrücken und darüber trauern, dass ihnen selbst wohl keine so schöne Beerdigung zuteil werden wird.
An American Sniper wirkt nichts oberflächlich effektheischend, obwohl er stellenweise Videospiel-Ästhetik besitzt und versucht Combat-Thrill nachzuempfinden, was im Kino beeindruckend rüberkommt. Die Bilder dienen konsequent der Story.
Nur welcher Story? Was uns gezeigt wird, ist überhaupt nicht die Geschichte dieses Films. Die wahre Geschichte geschieht zwischen den Bildern und man muss sie sich selbst zusammenreimen. Denn niemals wird ernsthaft die Frage nach der Berechtigung, dem Sinn, der Notwendigkeit des Krieges erhoben. Die Charaktere reflektieren die Hintergründe und Zusammenhänge nicht, sondern hadern eher mit sich selbst und ihrem Los. Zweifelt einmal wirklich ein Soldat am Sinn seines Einsatzes, dann stirbt er auch gleich darauf. Weil‘s tragischer ist und dem Helden einen Freund nimmt. Der böse Krieg entreisst dem Helden ständig Freunde und er leidet darunter, sie nicht alle retten zu können. (Am Rande: töten eigentlich Zweifel?)

Eastwoods Helden befinden sich fast immer auf der untersten Hierarchieebene, sie sind Befehlsempfänger. Sein liebster Protagonist ist der kleine Mann, der nichts machen kann, außer zu gehorchen oder persönlich aufzubegehren und dafür den Preis zu zahlen. So oder so. Es ist diese vordergründige Ungerechtigkeit, die Zuschauer Mitfühlen lässt, weil sie oftmals ihre Lebenserfahrung bestätigt.
In American Sniper ist für den Protagonisten der Krieg zu Ende, als er entscheidet, er hätte dem Vaterland genügend Opfer gebracht. Was weiter an der Front geschieht, geht ihn nichts mehr an. Kriegspielen ist wie Karusselfahren, man steigt aus, wenn man nicht mehr mitfahren will. Selbst wenn es in der Realität so geschehen sein sollte, liegt der Regisseur – absichtlich? – völlig daneben. Die freiwillige Abkehr vom Schlachtfeld erhöht nur das angesprochene persönliche Drama. Sie dient dramturgisch der Stilisierung des Täters zum Opfer.

Denn die ganze Prämisse der Story ist falsch. Es ist die Geschichte eines Killers. Diesen Film so wie Eastwood aus der Täterperspektive zu erzählen, das bedeutet, die wahre Tragödie zu ignorieren: die Geschichte der Opfer. Mal ehrlich, verbessert die ungebetene amerikanische Befreiung von einem grausamen Tyrannen die Situation einer notleidenden Bevölkerung? Nein, niemals, sie verschlimmert sie in der Regel. Wer daher die Frage nach dem Warum eines Krieges nicht grundsätzlich adressiert, ist letztlich ein Kriegspropagandist. Das gilt auch für Eastwood. Die Illegalität dieser Angriffskriege beschäftigt ihn nicht. Stattdessen heißt es: „Ein Mann tut, was ein Mann tun muss”. Die Western-Plattitüde wird mit den Worten „für Gott, Vaterland und Familie” im Sinne der herrschenden Ideologie erweitert und präzisiert. Der Slogan, vom Helden ausgesprochen, wirkt über dessen Tod hinaus.
Kyle haben einst die Terroranschläge vom 11. September 2001 an die Front getrieben, was ihn wie Tausende andere zu einem der ersten Opfer von Politikerlügen und US-Propaganda machte. In den Kriegen stirbt aber man nicht für die Sicherheit und Freiheit der Vereinigten Staaten, schon gar nicht für Demokratie und Menschenrechte anderer, man stirbt für das Öl und die Konzerne des Imperiums.
Zur vermeintlichen Tragik des Helden gehört es, dass ausgerechnet er von einem anderen Veteranen getötet wird. Damit das schön ominös daher kommt, muss Sienna Miller als Gattin des Protagonisten auch misstrauisch schauen, denn natürlich sieht der spätere Mörder gestört und irgendwie verschlagen aus. (Kyle hinterließ neben seiner Frau noch zwei Kinder.)
Beim wiederholten Blick auf den Film springen einem dann all die Klischees richtig ins Auge, die Eastwood reitet. Die gelernten Einstellungen, die ewig gleichen Bilder, wie aus einem Rekrutierungsvideo der US-Marines, pathetisch bis zur Unerträglichkeit. Wobei der Regisseur es geschickt versteht, sie nur bis an die Grenze des Aushaltbaren und nicht darüber hinaus aufzupumpen, wie man es bei peinlichen Regiefummlern wie Michael Bay immer sieht.

Weil American Sniper sich als handwerklich perfekt fabrizierte Propaganda präsentiert, ist er so ein perfides Machwerk. Schon sein Titel verweist auf Patriotismus: Amerikanischer Scharfschütze. (Heckenschütze wäre angesichts der Feigheit eines Snipers ehrlicher.) So eine Story der Superlative gibt es nur in Amerika. Auch im Morden die unverzichtbare Nation, zumindest in der ständig postulierten Selbstwahrnehmung.
Was soll daran heldenhaft sein? Hat man einmal diese übersteigerte Sichtweise erkannt, dann zeigt der Film bei allen persönlichen Opfern des Protagonisten nur scheinbar schonungslos und ehrlich die Realität. Das Gegenteil ist der Fall: Er verzerrt sie völlig. Plötzlichen sieht man einen total absurden Streifen, ungewollt komisch, stellenweise geradezu lachhaft albern.

Die ungebildete Naivität, man könnte auch sagen Dummheit, des Protagonisten, die von den Mächtigen gerne benutzt und ausgenutzt wird, ist besonders schwer erträglich. Kyle ist ein Befehlsempfänger und kein Held, mehr noch, er ist ein nützlicher Idiot. Von ihm bleiben am Ende nur die 160 registered kills übrig. Missetaten, die ihn zu The Legend machten, zu einem Vorbild für Heerscharen nützlicher Idioten nach ihm.
Der Film verschweigt darüberhinaus, wie Kyle sich nach seiner Militärzeit als Hochstapler und Lügner dekuvrierte: er verlieh sich mehr Ehrenmedaillen, als er je vom Militär erhalten hatte, und musste sich wegen seiner Diffamierung von Jesse Ventura, einem Ex-Seal und Vietnam-Veteranen, vor Gericht verantworten. Das Prozessende erlebte Kyle nicht mehr. Seine Witwe und der Herausgeber seiner Autobiografie betrieben das Verfahren weiter. Sie verloren in erster Instanz und verglichen sich mit Ventura vor Prozessbeginn in der zweiten Instanz. Diese Ereignisse werfen nicht nur Fragen hinsichtlich der Verifizierung der vorgenannten 160 registered kills auf, sie nehmen auch Kyles frühem Tod den letzten Hauch persönlicher Tragik.
Hätte Eastwood die wahre Geschichte des Snipers Chris Kyle erzählt, dann hätte es ein großer, weil wirklich tragischer und zugleich schrecklicher Film werden können. Der passt allerdings nicht in die vorherrschende Ideologie der Kriegsmaschine USA, und wenn wir ehrlich sind, auch nicht in die Erwartungshaltung des Publikums. Tell the people what they want – and give it to them.

Clint Eastwood, mittlerweile 89-jährig und immer noch unermüdlich im Geschäft, vergeudet sein Talent an die stets gleichen, öden Geschichten von persönlichem Heldentum. Trotzig und inbeirrt. Weil er halt nicht anders kann? Vielleicht ist aber genau das sein Talent. Beim Betrachten dieses Films ist mir klar geworden, Eastwood ist nicht Hamlet, wie Jörg Fauser ihn einst nannte, er war auch niemals Hamlet. Eastwood hat mit dem Shakespearschen Helden absolut nichts gemein. Denn Eastwood kennt keine Selbstzweifel, er zaudert nicht, er ist auch nicht tragisch oder absurd oder gar albern, selbst wenn er sich inzwischen gelegentlich so inszeniert und dafür von der degenerierten Filmkritik Beifall bekommt. Clint Eastwood war und ist Zeus, ein veritabler deus ex machina, der sich selbst überlebt hat, und die Propagandamaschine Hollywood ist sein Olymp.
Wie sagte schon der große Drückeberger Daffy Duck: „Wer sich jetzt nicht mit seiner Flinte ins Korn wirft, dem ist nicht zu helfen.”


Zu “guten” Clint Eastwood habe ich eine andere Position.
Er ist für mich ein Meister Männer/Helden zuzeigen denen in professioneller Hinsicht alles gelingt aber arme,einsame Wichte,sind.
Und ich sehe eine grosse Ironie in seiner Darstellung der Zerstörung der übertriebenen Männlichkeit und des Heroismus.
Männer,die von Uniformen,Kodexen, oder was auch immer zusammengehalten werden/besessen,danach süchtig sind, aber tatsächlich keine Kreativität oder Empathie besitzen.
Und ganz grosses Satire-Kino war sein Chair-Talk auf dem Republikaner-Partei-Tag.
Er hält sie alle zum Narren, die Lachfalten in seinen Augenwinkeln sprechen Bände!
Man sollte seine richtigen Filme(wo man die Liebe spürt) nicht ausser acht lassen:
Bird,Honkytonk-Man,Mitternacht im Garten..,Space-Cowboys (pure Satire!),Perfect World,Sully!
Und noch ein paar mehr!!!
Aber genau wie jeder denkende Mensch und Filmeliebende ist er kein Freund von Reboots/Remakes,
ist ein ausdruck von Ideenlosigkeit!
“There’s a rebel lying deep in my soul.
Anytime anybody tells me the trend is such and such, I go the opposite direction.
I hate the idea of trends.
I hate imitation; I have a reverence for individuality.
I got where I am by coming off the wall.
I’ve always considered myself too individualistic to be either right-wing or left-wing.”
Clint Eastwood
Wie heißt der Regisseur im Deutschen:
Spielleiter….
Eastwood zelebriert, was er vermeintlich hinterfragt. Wenn er die Lächerlichkeit des Heroismus aufzeigt, ist das Ausdruck seiner inneren Widersprüche, die er als intelligenter Mensch und Kreativer nicht leugnen kann. Am Ende erliegt er immer seinen eigenen heroischen Sehnsüchten – und das macht ihn so systemgläubig. Die von dir zitierte Interview-Aussage ist die in den USA populäre Postion eines Mavericks (John McCain war angeblich auch einer), jemand der sich lautstark gegen den Strom stellt, in Wahrheit aber von ihm mitgerissen wird.